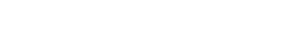PROF. DR. REGINE KATHER (PHILOSOPHIN, UNIVERSITÄT FREIBURG): „DAS ‚PRINZIP VERANTWORTUNG‘ ALS LEITMOTIV DES HANDELNS“
„Das ‚Prinzip Verantwortung‘ als Leitmotiv des Handelns: Von den Grenzen unbeschränkten Wachstums und der Entdeckung neuer Lebensqualitäten.“
Abstract:
Durch den Klimawandel werden, darin sind sich Ökologen und Ökonomen inzwischen einig, Lebensqualität und Lebensstandard in den nächsten Jahrzehnten drastisch sinken. Eine soziale Neuorientierung kann jedoch allein durch die moderne Technik nicht vollzogen werden, hat diese doch den ressourcenintensiven Lebensstil überhaupt erst ermöglicht. Erst die Entdeckung neuer Lebensqualitäten und Werte, sinnlicher wie sozial-ethischer, ermöglicht eine Abkehr von einer auf steter Konsumsteigerung basierenden Form der Ökonomie. Ausdrücklich hat der Philosoph Hans Jonas auf die Verantwortung des Menschen für die kommenden Generationen und die Ordnung der Natur aufmerksam gemacht: Unsere Verantwortung, so Jonas, reicht soweit wie unsere Macht. Da diese in räumlicher Hinsicht eine globale Reichweite gewonnen hat und sich in zeitlicher Hinsicht auf unüberschaubar viele Generationen erstreckt, gewinnt die Zeit für das Handeln eine bisher in keiner Ethik bedachte Bedeutung: ‚Die Zukunft‘, so Jonas, ‚wird zum unabgeschlossenen Horizont unserer Verantwortung‘. Sie erstreckt sich nicht nur auf die Mitmenschen, sondern auch auf die Natur. Als Grundlage allen Lebens und Voraussetzung eines menschenwürdigen Lebens ist sie weit mehr als eine Ressource, die der Erfüllung unserer Wünsche dient. Ihre Dynamik beruht nicht nur auf einer räumlichen, sondern auch auf einer zeitlichen Ordnung, auf die auch Menschen angewiesen sind. Die Bereitschaft, die eigenen Interessen nicht zum Maß aller Dinge zu erheben, gehört zu den größten Herausforderungen auf dem Weg zu einer Neuorientierung. Welche Lebensqualitäten könnten daher so verlockend sein, dass sie zu einer Veränderung des Lebensstils, zur Überwindung von Bequemlichkeit und liebgewordenen Gewohnheiten motivieren? An welchen Werten müsste sich eine Ökonomie orientieren, die nicht nur einem würdelosen Konsumismus eine Absage erteilt, sondern auch die Bedingungen des Lebens bewahrt, die nicht auf Ausbeutung, sondern auf Ausgleich und Teilhabe beruht.
Durch den Klimawandel werden, darin sind sich Ökologen und Ökonomen inzwischen einig, Lebensqualität und Lebensstandard in den nächsten Jahrzehnten drastisch sinken. „Die wichtigste Erkenntnis,“ so formuliert der Biologe Reichholf, „die von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft gegenwärtig geteilt wird, lautet, dass unser ressourcenschweres westliches Wohlstandsmodell (heute gültig für eine Milliarde Menschen) nicht auf weitere fünf bis zum Jahr 2015 oder sogar auf acht Milliarden Menschen übertragbar ist. Das würde alle biophysikalischen Grenzen unseres Systems Erde sprengen.“(i) Nicht nur der an wachsendem Konsum orientierte westliche Lebensstil, der derzeit auch von Schwellen- und Entwicklungsländern angestrebt wird, sondern seine Verbindung mit einem rapiden Bevölkerungswachstum, das sich vor allem in den ärmeren Ländern der Erde vollzieht, sind entscheidend für die Ausbeutung der Natur.
Schon aus schierem Eigennutz, unabhängig von der viel weiter reichenden Frage nach Lebensziel und Lebenssinn, ist eine Änderung des Lebensstils unter einer Voraussetzung unabdingbar: dass nämlich die Menschen weiterhin einigermaßen gut, mithin ohne extreme physische Einschränkungen und sozial befriedet leben wollen. Dabei stellt sich freilich schon an dieser Stelle die Frage: Warum eigentlich wollen Menschen überhaupt überleben und darüber hinaus auch noch qualitativ gut leben? Warum sollte uns die Zukunft nicht völlig egal sein, – zumal wenn wir selbst von den drohenden Veränderungen gar nicht betroffen sind? Was sind die Gründe, die zu einer Verhaltensänderung motivieren können? Handelt es sich lediglich um die Angst vor dem eigenen Tod und vielleicht um die Sorgen um die eigenen Kinder, also einen biologisch zu beschreibenden Mechanismus? Dann würde es freilich genügen, für sich und seine nächsten Angehörigen vorzusorgen. Unter diesen Voraussetzungen wäre schon das Überleben der Gattung Mensch unwichtig. Schließlich, so argumentieren rein naturwissenschaftlich eingestellte Biologen und Physiker, hat es die Menschheit lange Zeit nicht gegeben und auch der Planet Erde ist nach astrophysikalischen Maßstäben dem Untergang geweiht. Diese Art der Argumentation lenkt daher den Blick auf ein methodisches Problem: Die Naturwissenschaften wie Physik, Biologie oder Ökologie und die sich an ihrer Methode orientierenden Sozialwissenschaften, können nicht begründen, warum es überhaupt Menschen und darüber hinaus auch noch andere Kreaturen geben sollte. Die Suche nach einer Antwort auf die Frage nach dem Wozu des Überlebens und eines qualitativ guten Lebens führt daher unweigerlich in die philosophische Ethik. Sie erklärt nicht nur, wie Systeme funktionieren, sondern welche Werte angestrebt werden sollten. Nicht die Frage, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert, sondern wozu ein System funktionieren sollte ist daher die Grundlage für eine Neuorientierung des Individuums wie der Gesellschaft.
Damit sind wir bei einem weiteren Problem angekommen: Was eigentlich ist die Ursache für die unheilvolle Dynamik der modernen Lebenswelt? Das soziale System, mithin ein abstrakter, höchst komplexer Mechanismus, – oder die Individuen? Die Art der Fragestellung weist auf eine Polarisierung der Diagnose hin, der man vielerorts begegnet: Entweder das System muss sich verändern, dann können auch die Individuen anders leben, – oder die Individuen tragen die Verantwortung dafür, dass das System so ist, wie es ist. Meiner Meinung nach ist, wenn man einen systemorientierten Ansatz vertritt, beides richtig. Schließlich geht die Systemtheorie davon aus, dass sich Teil und Ganzes gegenseitig bedingen. Das Funktionieren des Systems wird von der Vielzahl seiner Teile mit erzeugt; diese sind ihrerseits keine vom System unabhängigen Entitäten, sondern in ihrer Individualität auf Strukturen angewiesen, die es ihnen ermöglichen, mit anderen in Austausch zu treten und ihre soziale Funktion zu erfüllen. Ein radikaler Individualismus greift zu kurz, weil er übersieht, dass Menschen, wie alle anderen Kreaturen auch, auf Beziehungen zu ihrer physischen und ihrer sozialen Umwelt angewiesen sind. Einerseits finden sie sich in Beziehungen vor, die sie nicht gestaltet haben, andererseits gestalten sie diese ihrerseits durch ihre Eigenaktivität, ihre Ziele und Werte, mit. Ebenso einseitig wie ein radikaler Individualismus ist die Erklärung des Verhaltens durch die Zwänge eines Systems: Er übersieht die menschliche Freiheit und damit auch die Verantwortung des Individuums für seine Lebensführung. Ohne diese wäre auch das Bemühen um eine Veränderung des Lebensstils kausal bedingt und damit ziel- und sinnlos. Zugespitzt gesagt: Wenn sich das Verhalten vollständig kausal erklären ließe, dann hätten auch wir hier keinerlei Freiheit, die Bedingungen zu beeinflussen; auch dieses Symposion und sein Verlauf wären kausal bedingt. Juristisch gesehen wären Menschen nicht mündig. Notwendig ist daher ein Ansatz, der die von den Individuen ausgehende Möglichkeit zur Eigeninitiative ebenso berücksichtigt wie kausal wirkende, systemische Zwänge. Absolute Freiheit, eine Freiheit ohne jegliche Grenzen und Bedingungen, ist sinnlos. Bindungen und Vorgaben sind, mit Karl Jaspers gesprochen, geradezu die Voraussetzungen, die die individuelle Freiheit herausfordern und an denen sie sich bewähren muss. Nur wenn man beide Formen der Kausalität berücksichtigt, die Determinanten ebenso wie die Möglichkeit zur Eigeninitiative, entgeht man dem Antagonismus von Allmacht und Ohnmacht: der Überzeugung, dass man entweder die ganze Welt verändern, – oder gar nichts tun kann. Nur wenn man von dem Ineinander von Notwendigkeit und Freiheit ausgeht, kann jeder Einzelne seinen besonderen, historisch bedingten Kontext und die Reichweite seiner persönlichen Verantwortung richtig einschätzen.
Damit kommen wir zu einer dritten Frage: Welche Faktoren erzeugen die Dynamik, die die Grundlage des menschlichen Lebens bedroht? Ein systemischer Ansatz, der von der Interaktion von Teil und Ganzem ausgeht, macht monokausale Erklärungen noch in einer anderen Hinsicht unmöglich: Nicht ein einzelner Faktor, sondern erst das spezifische, historisch entstandene Zusammenspiel verschiedener Momente, die allesamt für die Kultur entscheidend sind, erzeugt die gegenwärtige Krise. Diese ist zugleich eine ökonomische, ökologische und ethisch-humane. Ihren Ursprung hat sie in einer Weichenstellung, die im 15. Jahrhundert erfolgte, als sich der Fortschritt der Naturwissenschaft mit dem der Technik und der Lebenswelt verband und die Natur zu einem naturgesetzlich zu erklärenden, wertlosen Objekt wurde.
Aufgrund ihrer Methode sind die Naturwissenschaften untrennbar mit dem Fortschritt der Technik verbunden; dieser beruht seinerseits auf einer immer genaueren Erkenntnis der Naturgesetze. Wissenschaftliche Erkenntnisse sollen, so formulierte Nicolaus Cusanus zum ersten Mal ausdrücklich, wiederum den humanitären Fortschritt fördern und die Lebensqualität verbessern. Hinzu kam mit der Aufklärung die Überzeugung, dass jeder Mensch aufgrund seiner Vernunft ein selbstbestimmtes Leben führen könne und solle. Dabei sollte es sich jedoch nicht nur, wie Kant glaubte, um die Freiheit handeln, sich an ethischen Prinzipien zu orientieren, sondern, im Sinne des Utilitarismus, um das Glück der größtmöglichen Zahl. Entscheidungen wurden danach beurteilt, ob sie der Maximierung des Glücks dienten. ‚Wohlstand für alle‘ wurde zum sozialen Programm. Dadurch entstand eine Form der Ökonomie, die Güter, die zuvor nur wenigen zugänglich waren, für immer mehr Menschen erreichbar machten. Nicht mehr Subsistenz, sondern die Mehrung der Güter wurde zum Ziel der Ökonomie. Damit vollzog sich auch eine Umwertung der Arbeit: Sie diente nicht mehr der Lebenssicherung, sondern wachsendem Wohlstand. Die Muße, sich kreativen Tätigkeiten zu widmen, die in Hinblick auf den sozialen Status unwichtig waren, wurde von der Freizeit abgelöst, die der Regeneration von der Arbeit dient und inzwischen zu einem wichtigen Teil der Konsumgesellschaft wurde. Was freilich ‚Glück‘ wirklich ist, war schon bei den frühen Utilitaristen umstritten. Ist ein vollgefressenes Schwein glücklicher als Sokrates, der um des Glücks der Erkenntnis und eines ethischen Lebens willen auf viele Annehmlichkeiten verzichtet? Tatsache ist, dass spätestens im 20.Jahrhundert für immer mehr Menschen das sinnlich-vitale Wohlbefinden, Lust und Spaß, zum Lebensinhalt wurden; ‚Mühsal und Plage‘, Anstrengung in jeder erdenklichen Form, werden dagegen immer mehr als etwas gesehen, was sich mit Hilfe der modernen Technik ausschalten lässt. Die Entwicklung der Technik erscheint bis heute als Garant des humanitären Fortschritts und von steigender Lebensqualität. Dieser Dynamik, so Jonas, kann man sich nicht entziehen: “Jeder neue Schritt in irgendwelche Richtung in irgendeinem technischen Gebiet steuert nicht etwa auf einen Gleichgewichts- oder ‘Sättigungs’-Punkt in der Anpassung von Mitteln an vorgegebene Zwecke zu, sondern – im Gegenteil – wird im Erfolgsfall der Anlaß zu weiteren Schritten in alle möglichen Richtungen.”1 „Moderne Technik (ist) ein Unternehmen und ein Prozeß, während frühere ein Besitz und ein Zustand war. Jeder technischen Neuerung ist es sicher, sich schnell durch die technologische Ökumene zu verbreiten. Technologie fügt den Gegenständen menschlichen Begehrens und Bedürfens neue hinzu – und vermehrt damit auch ihre eigenen Aufgaben. Zwecke, die zunächst ungebeten und vielleicht zufällig durch technische Erfindungen erzeugt wurden, werden zu Lebensnotwendigkeiten, wenn sie erst einmal der sozialökonomischen Gewohnheitsdiät einverleibt sind, und stellen dann der Technik die Aufgabe, sich ihrer weiter anzunehmen und die Mittel zu ihrer Verwirklichung zu vervollkommnen. ‚Fortschritt’ ist nicht eine bloß von ihr angebotene Option, die wir ausüben können, wenn wir wollen, sondern ein in ihr selbst gelegener Antrieb, der sich über unseren Willen hinweg auswirkt. ‚Fortschritt’ ist hierbei kein Wertbegriff, sondern rein beschreibend. Wir mögen seine Tatsache beklagen und seine Früchte verabscheuen und müssen doch mit ihm gehen. Es liegt in der Natur der Sache, daß jedes spätere Stadium nach den Kriterien der Technik selbst dem vorangehenden überlegen ist.“[ii] Die der Bewertung der Technik zugrunde liegende Voraussetzung ist, dass es unbegrenzten Fortschritt geben kann und soll, weil es immer wieder etwas Neues und Besseres zu finden gibt und dieses der Humanität zu dienen scheint. Durch die Technik vollzieht sich eine unablässige Beschleunigung des Alltagslebens, der sich viele nur noch mit Hilfe von Medikamenten und Enhancement-Technologien gewachsen fühlen.
Doch ist die Technik wirklich der Garant für wachsenden Wohlstand und steigende Lebensqualität? Lassen sich Wohlbefinden und Glück technisch erzeugen? Alle technischen Erzeugnisse sind zwiespältig, sie lassen sich zum Guten wie zum Bösen einsetzen. Da jedoch sowohl anthropologisch wie unter den Bedingungen der Gegenwart ein Leben ohne Technik undenkbar wäre, gilt es immer wieder zu fragen, welche Formen der Technik wirklich dem menschlichen Leben dienen, – welche dagegen nur der Steigerung des Konsums und der Gewinnmaximierung nützen. Wie etwa, um einige Beispiele zu nennen, wirkt sich die Erzeugung von Energie durch Mais und andere Futterpflanzen auf die Biodiversität aus? Welchen Interessen dienen die mit Quecksilber gefüllten Energiesparlampen wirklich? Sparen wir damit überhaupt Energie? Und wie sieht die Energiebilanz bei der Dämmung von Häusern mit Styropor oder anderen Stoffen aus? All diese Technologien werden mit hohen Subventionen gefördert und sind mit der Verheißung verbunden, dass effizientere Technologien die ökologischen Probleme lösen können, ohne dass sich der Lebensstil und die ihm zugrunde liegenden Werte ändern müssen, dass also das Wirtschaftswachstum, das auf wachsendem Konsum beruht, ungebrochen weitergehen kann – nur dass nun eben andere Güter konsumiert werden. Die diesem Credo, das derzeit von allen führenden Politkern quer durch die Parteien und von den Leitern der großen Geldinstitute wie der EZB oder der FED verkündet wird, zugrunde liegende Einstellung bezeichnet Jonas als Völlerei, mithin mit einem Wort, das ehemals eine der sieben Todsünden bezeichnete. Als Völlerei galten Verhaltensweisen, die Ausdruck von Enthemmung und Maßlosigkeit waren und denen eine Perversion, eine Verkehrung der Rangordnung der Werte zugrunde lag. Die Vernunft wurde in den Dienst der Triebnatur des Menschen gestellt. Jonas‘ Diagnose, die er bereits vor vierzig Jahren formulierte, gewinnt daher eine ungeahnte Aktualität. „‘Völlerei‘ im weitesten Sinne der Konsumtüchtigkeit (wird) nicht nur durch üppigsten, allzugänglichen Güterreichtum begünstigt, sondern (ist) auch als fleißiges omnivores Konsumieren des dazu erzeugten Sozialproduktes geradezu ein notwendiges und verdienstliches Mitwirken am Laufen der modernen Industriegesellschaft geworden, die ihren Mitgliedern zugleich das Einkommen dazu verschafft. Alles ist auf diesen Erzeugungs- und Verzehrkreislauf eingestellt, unaufhörlich wird in der Reklame jeder zum Verzehren ermahnt, angestachelt, verlockt. ‚Völlerei‘ als sozialökonomische Tugend, ja Pflicht – das ist wahrlich ein geschichtlich Neues im jetzigen Augenblick der westlichen Welt.“[iii] Die von Gier getriebenen Menschen sind, trotz der Fülle an Wahlmöglichkeiten, die ihnen suggerieren, alles gleichzeitig haben zu können, innerlich unfrei. Deshalb ist für Jonas der enthemmte Konsumismus der Gegenwart auch Ausdruck von Würdelosigkeit. In dem Run nach immer mehr und immer billiger verstoßen die Menschen, mit Kant gesprochen, gegen die Achtung, die sie sich selbst und anderen schulden.
Eine soziale Neuorientierung kann daher weder nur durch ein ökonomisches Umdenken noch allein durch die moderne Technik vollzogen werden. Erst beide zusammen ermöglichen den ressourcenintensiven Lebensstil. Auch die Technik ist daher, so hat schon Ernst Cassirer beobachtet, kein wertneutrales Hilfsmittel, das man weglegen kann wie einen Hammer, den man zum Einschlagen eines Nagels benutzt. In ihr spiegeln sich die ethischen Werte, die Bedürfnisse und Ziele des Konstrukteurs und der Gesellschaft, für die er etwas erfindet. ,Technology’, so heißt es in der ,Encyclopedia of Science and Religion’, „understood as practical implementation of intelligence, is a matter of know-how expressing values.“[iv]
Erst die Entdeckung neuer Lebensqualitäten und Werte, sinnlicher wie sozial-ethischer, ermöglicht eine Abkehr von einer auf steter Konsumsteigerung basierenden Form der Ökonomie, eine Umwertung der Bedeutung der Technik und der Arbeit. Die Änderung eines Faktors wird eine Neubewertung aller anderen Momente, die derzeit für die westliche Kultur prägend sind, nach sich ziehen. Motiviert wird dieser Prozess jedoch nun nicht mehr durch den unmittelbaren Eigennutz, sondern durch ethische Gründe. Da nur vernunftbestimmte Wesen ihre Interessen und Handlungen im Licht ethischer Reflexionen prüfen und korrigieren können, sind nur sie für diese verantwortlich. Verantwortung setzt voraus, dass sich ein Individuum als dieselbe Person in wechselnden Kontexten wiedererkennen und sich als Ursprung einer Handlung erkennen kann. Dabei stellen sich mehrere Fragen, die eine unterschiedliche Reichweite des Handelns und damit unterschiedliche Motivationen zum Handeln beinhalten:
- Was eigentlich ist die Grundlage des menschlichen Lebens? Welche Rolle spielen andere Menschen und die Natur?
- Haben Menschen nur für sich selbst Verantwortung, – oder auch für kommende Generationen? Wenn ja, warum eigentlich?
- Haben Menschen das Recht, die ganze Natur für ihre eigenen Bedürfnisse zu beanspruchen und allen anderen Kreaturen ihren Lebensraum streitig zu machen? Ist die Natur nur ein naturgesetzlich zu beschreibender, wertloser Funktionszusammenhang, den Menschen nach eigenem Gutdünken benutzen können? Oder hat die Biosphäre, der Lebensraum aller Lebewesen auch einen ‚sittlichen Eigenwert‘? Und wenn ja: Was bedeutet das für das menschliche Handeln?
- Und schließlich: Welche Motive könnten uns dazu bewegen, entsprechend unserer Einsicht zu handeln?
Die Tatsache, dass es Menschen gibt, begründet noch nicht, dass es auch in Zukunft noch Menschen geben soll. Nur wenn man das menschliche Leben als ein Gut, als einen Wert ansieht, den es zu erhalten gilt, kann man begründen, dass wir unsere Lebensweise so einrichten sollen, dass die Grundlagen des Lebens nicht zerstört werden. Dass sich die moderne Ethik, anders als jede frühere, mit der Frage befasst, ob es auch in Zukunft noch Menschen geben soll, liegt an der Ausweitung der Macht: Diese hat durch die moderne Technik in räumlicher Hinsicht eine globale Reichweite gewonnen hat und erstreckt sich in zeitlicher Hinsicht auf unüberschaubar viele Generationen. Zum ersten Mal ist durch die moderne Technik die Möglichkeit entstanden, die biologische Grundlage des Lebens auf der Erde zu vernichten. Dadurch steht nicht nur das Überleben des Einzelnen auf dem Spiel oder das gute Leben Platons, sondern das Überleben der Menschheit. Wenn Verantwortung, wie Jonas argumentiert, ein Korrelat zur Macht ist, die jemand, eine Institution oder die Gesellschaft insgesamt haben, dann wird ‚die Zukunft zum unabgeschlossenen Horizont unserer Verantwortung‘. Es genügt nicht mehr, nur die Gesinnung eines Menschen, seine Motive zu berücksichtigen; auch die möglichen Folgen einer Entscheidung müssen mit abgeschätzt werden. Die Gesinnungsethik muss durch die Verantwortungsethik ergänzt werden. Jonas formuliert daher einen erweiterten kategorischen Imperativ, der bei allen Entscheidungen, die zu einer Zerstörung der Lebensgrundlage führen könnten, das Handeln leiten sollte: „ ‘Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden;’ oder einfach; ‘Gefährde nicht die Bedingungen für den indefiniten Fortbestand der Menschheit auf Erden’; oder, wieder positiv gewendet: ‘Schließe in deine gegenwärtige Wahl die zukünftige Integrität des Menschen als Mit-Gegenstand deines Wollens ein’.”[v]
Der erweiterte kategorische Imperativ bezieht somit zwei Aspekte ein, die frühere Ethiken nicht beachtet haben: Die Zeitdimension des Handelns und die Bedeutung der Natur als Lebensgrundlage der Menschheit. Sieht man im Überleben nicht nur des Einzelnen, sondern der Menschheit und möglicherweise auch anderer Kreaturen einen ethischen Wert, dann entspringt daraus die Pflicht, die Lebensbedingungen, soweit es in der Hand der Menschen liegt, zu erhalten.
Die Reichweite der Verantwortung ist für Jonas ein Korrelat zur Macht, die Menschen haben – als Individuen und als Repräsentanten von Institutionen und Staaten. Die Beschränkung auf regionale oder nationale Interessen ist angesichts der globalen Reichweite des Handelns unzureichend. Je umfassender die Macht ist, desto weiter reicht die Verantwortung – räumlich wie zeitlich. Doch die Menschen sollten nicht nur überleben, sondern ihre körperlichen und geistigen Möglichkeiten, zu denen auch ethische Pflichten gehören, entfalten können. Die Sicherung des Lebensstandards kann hierfür nur ein begrenztes Mittel sein. Dabei kann freilich schon die Summierung unzähliger einzelner Handlungen eine globale Wirkung haben, wie wir spätestens seit der Entstehung des Ozonlochs wissen: Spraydosen und Kühlschränke, Autos und Ernährungsgewohnheiten zahlloser Individuen summieren sich und erzeugen globale Effekte. Menschen stehen nicht außerhalb der Biosphäre, sondern sind ein wirkender Faktor in ihr. Obwohl kein Individuum die großräumigen Effekte verhindern kann, trägt es doch zu deren Entstehung oder auch Abschwächung mit bei.
Als biologische Wesen können Menschen nicht unabhängig von der Ordnung der Natur überleben; als soziale Wesen sind sie auf eine Gesellschaftsordnung angewiesen, die ihnen die Entfaltung ihres genuin menschlichen Potenzials ermöglicht. Die menschliche Identität, so haben wir bereits gesagt, ist relational bestimmt. Nur durch die Beziehung zu anderen Menschen und der Natur können Menschen ihre Identität entwickeln. Das, was sie sind, verdanken sie nicht nur ihrem eigenen Lebensentwurf, sondern auch dem, was sie von anderen empfangen. Soll diese Kette von Geben und Nehmen nicht abreißen, müssen Menschen das, was sie selbst schätzen, an die kommenden Generationen weitergeben. An dieser Stelle kommt daher noch ein weiterer Grundbegriff der Ethik ins Spiel: der der Gerechtigkeit. Schon sehr früh erkannte man, dass eine Gemeinschaft nur befriedet leben kann, wenn das Handeln von einem Ausgleich von Geben und Nehmen bestimmt ist, wenn man nicht nur nimmt, sondern auch gibt. Auf die gegenwärtige Problematik bezogen bedeutet das, dass es ungerecht wäre, wenn eine Generation für ihren eigenen Wohlstand die Güter der Erde verzehren und der nächsten Generation nur den Müll und die Not hinterlassen würde.
Aus dieser Einsicht entstand ein neuer ethischer Begriff, der freilich inzwischen fast zu einem sinnleeren Joker wurde: die Verpflichtung zum nachhaltigen Handeln. Ursprünglich stammt der Begriff, der 1713 von Hans C. von Carolowitz geprägt wurde, aus der Forstwirtschaft. Er diente zur Charakterisierung der Bewirtschaftungsweise eines Waldes, bei der nur so viel Holz entnommen werden darf wie nachwachsen kann. Damit sich der Wald immer wieder regenerieren kann, darf er nie vollständig abholzt werden. Dadurch würden auch die in der Holzwirtschaft tätigen Unternehmen ihre Existenzgrundlage verlieren, so dass sie selbst ein Interesse am Erhalt des Baumbestandes hatten. Nachwachsen können Bäume freilich nur, wenn man ihre Wachstumsbedingungen erhält, zu denen eine Vielzahl anderer Kreaturen und anorganische Stoffströme, vor allem Boden und Wasser, gehören. Damit Holz nachwachsen kann, muss man die Zeitskalen beachten, die bestimmte Baumarten benötigen. Weder die Umweltbedingungen noch die zeitlichen Maßstäbe können von Menschen festgelegt werden. Kurzfristige Interessen, so erkannte man, müssen in den wirtschaftlichen Ruin führen.
Zunächst ging man jedoch davon aus, dass es genügt, den Baumbestand rein quantitativ zu erhalten, so dass an die Stelle von Mischwäldern Monokulturen traten, die das Kriterium der Nachhaltigkeit zu erfüllen schienen. Erst in den letzten Jahrzehnten erkannte man, dass diese für Krankheiten und Windbruch sehr anfällig sind und sich die Fruchtbarkeit der Böden schnell erschöpft. Nicht allein die Quantität der Bäume, sondern auch ihre Zusammensetzung ist daher für eine nachhaltige Waldwirtschaft entscheidend. Wieder kommen wir zu dem Gedanken zurück, dass die Relationen, die ein Ökosystem ausmachen, erhalten werden müssen, damit es sich aus eigener Kraft regenerieren kann. Diese Relationen hängen aber von der Artenvielfalt und den anorganischen Stoffströmen ab.
Der heute maßgebliche Begriff der nachhaltigen Entwicklung wurde 1987 von der Brundtland-Kommission definiert. Er beinhaltet ‚eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstandard zu wählen.‘ Nachhaltiges Wirtschaften fordert die Orientierung an den zeitlichen Dimensionen, die bestimmte Ressourcen wie Wasser, Böden, Wälder und Tiere zur Regeneration benötigen. Deren Zeitskalen, und nicht menschliche Interessen, legen fest, in welchem Umfang sie benutzt werden dürfen. Die jeweils lebende Generation hat die ethische Verpflichtung, den Planeten so zu hinterlassen, dass auch künftige Generationen überleben und ein qualitativ gutes Leben führen können. Was allerdings unter ‚Bedürfnissen‘ zu verstehen ist, ist interpretationsbedürftig, und ob ein nachhaltiger Lebensstil tatsächlich mit einer freien Wahl des Lebensstandards verträglich ist, erscheint fragwürdig. Entscheidend ist jedoch der Impuls, dass die gegenwärtige Generation die Ressourcen nicht soweit aufbrauchen darf, dass die kommenden Generationen keinen Spielraum für ihre Lebensgestaltung mehr haben. Weder die gigantische Staatsverschuldung noch die Erzeugung und Lagerung von atomarem Müll, der noch etliche Jahrtausende strahlen wird, ist mit der Erklärung, dass jede Generation ihre Probleme lösen müsse und sie nicht den kommenden Generationen aufbürden dürfe, zu vereinbaren. Das Glück der gegenwärtigen Generation darf nicht, so hat Jonas bereits 1979 in seinem Werk ‚Das Prinzip Verantwortung‘ gefordert, mit dem Unglück oder gar der Vernichtung späterer Generationen erkauft werden.
[Erste, zögerliche Schritte in diese Richtung wurden auf dem Umweltgipfel 1992 in Rio de Janeiro und allen nachfolgenden Klimakonferenzen unternommen: Die Erhaltung der Biodiversität zusammen mit der nachhaltigen Entwicklung sei, so die Erklärung, eines der Hauptziele der Staatengemeinschaft der Erde. Auch die Bundesregierung hat sich bei der Konferenz von Rio dazu verpflichtet, nachhaltige Wirtschaftsformen zu unterstützten. Nur dann kann die Politik ihrem Auftrag gerecht werden, das physische, psychische und soziale Wohlergehen der Bevölkerung und der kommenden Generationen zu sichern. 2007 veröffentlichte das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung folgende Verlautbarung: „Wohlstand und Lebensqualität für heutige und künftige Generationen zu sichern sind zentrale Aufgaben der Politik. Sie folgt dabei dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung: jede Generation muss ihre Aufgaben lösen und darf sie nicht den nachkommenden Generationen aufbürden. 1992 haben sich die Vereinten Nationen zum Leitbild der nachhaltigen Entwicklung bekannt, indem sie in Rio de Janeiro ein globales Aktionsprogramm verabschiedeten. Mit der „Agenda 21“ erklärte sich jeder der über 170 Unterzeichnerstaaten, auch Deutschland, bereit, das Leitbild national in allen Politikbereichen unter Beteiligung von Gesellschaft und Wirtschaft umzusetzen. Die Bundesregierung hat 2002 eine Strategie vorgelegt, die für alle Politikfelder konkrete Nachhaltigkeitsziele formuliert. Die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ist Ziel und Maßstab des Regierungshandels, auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.“]
Mit einer Ethik, die nicht nur auf Konsens und der Orientierung an den Bedürfnissen der Mehrheit der Menschen beruht, ist in anthropologischer Hinsicht ein verändertes Selbstverständnis gefordert: Identität kann nicht nur auf der bewussten Identifikation mit Interessen oder, wie Sartre glaubte, auf dem eigenen Lebensentwurf beruhen. Sie gründet nicht nur beiläufig, sondern wesentlich auf der durch den Leib vermittelten Beziehung zur Natur. Das Akzeptieren von etwas, das sich der Verfügbarkeit entzieht, erscheint als Bedingung der Möglichkeit eines selbstbestimmten und ethisch verantwortlichen Lebens. Die Verantwortung erstreckt sich demnach nicht nur auf die Mitmenschen, sondern auch auf die Natur.
Ihre Dynamik beruht nicht nur auf einer räumlichen, sondern auch auf einer zeitlichen Ordnung, auf die auch Menschen angewiesen sind. Im Unterschied zur gemessenen Zeit ist die Dynamik ökologischer und biologischer Systeme nicht linear und zukunftsoffen, sondern durch zyklisch-wiederkehrende Prozesse bestimmt, die miteinander korreliert sind. Die Stabilität von Ökosystemen beruht auf der Korrelation der Eigenzeiten von Lebewesen. Die Anpassung ökologischer Prozesse an die lineare, getaktete Zeit der Ökonomie und der Arbeitswelt ist daher nur innerhalb enger Grenzen möglich, so dass ein Konflikt zwischen der ständigen Beschleunigung des modernen Lebens und der vergleichsweise langsamen Regeneration natürlicher Ressourcen und der wechselseitigen Abhängigkeit vieler natürlicher Prozesse voneinander unvermeidbar ist. Beachtet werden müssen außerdem die Zeiten, die anorganische Stoffe wie Wasser und Boden benötigen, um sich zu regenerieren. Auch sie hängen nicht nur von chemischen Prozessen, sondern auch von den Aktivitäten zahlloser Organismen ab. Ein Abwenden der ökologischen Krise beinhaltet daher auch die Integration der Zeiten des Lebendigen in den sozialen Umgang mit Zeit. Ein nachhaltiger Umgang mit der Natur, so heißt es in einer Broschüre des Deutschen Bundestages, ist nur gegeben, wenn „das Zeitmaß menschlicher Eingriffe in die Umwelt in einem ausgewogenen Verhältnis zum Zeitmaß der Reaktionsvermögen der natürlichen Stoffe steht.”[vi]
[Aufgrund der Interaktion zahlloser Prozesse in einem Ökosystem entscheidet nicht allein die Stärke eines Eingriffs über dessen Wirkung; berücksichtigt werden muss auch die Vernetzung von Zeitskalen. Sie entscheidet mit darüber, ob sich geringfügige Effekte durch Überlagerungen aufschaukeln oder starke Störungen gedämpft werden. Je großräumiger und komplexer ein System ist, desto länger braucht es, bis Störungen wieder abgeklungen sind. Nur wenn der Zeitpunkt eines Eingriffs bedacht wird, können Störungen aufgrund der Elastizität eines Systems integriert werden, so dass es sich gemäß seiner Eigendynamik weiterentwickeln kann. Der Umfang, die Geschwindigkeiten und die Zeitpunkte von Eingriffen müssen daher mit den Eigen- und Systemzeiten ökologischer Prozesse verträglich sein.
Zumindest bei einigen regenerierbaren Ressourcen gibt es erste Ansätze zu einer Institutionalisierung der Kontrolle nachhaltigen Wirtschaften: Der Forest Stewardship Council (FSC), eine internationale, gemeinnützige Organisation, hat die Verpflichtung übernommen, die Regeneration der Wälder zu überwachen. Die Motive der Holzkonzerne, nachhaltig zu wirtschaften, sind auch heute in der Regel ökonomischer Natur. Ähnlich dramatische Folgen wie die Abholzung der Wälder für die ökonomischen Interessen der Unternehmer hat inzwischen die Überfischung der Meere. Die Missachtung der Zeitskalen, die die Fischbestände zu ihrer Regeneration benötigen, bedroht und vernichtet die Existenzgrundlage zahlloser Fischer weltweit. Wie der FSC ist der Marine Stewardship Council daher bestrebt, Fische, die nachhaltig gefangen wurden, für den Verkauf zu kennzeichnen. „Die durch Überfischung verursachten Schäden gehen weit über unsere zukünftigen Aussichten auf Fischmahlzeiten hinaus, und sie enden auch nicht beim Überleben der einzelnen Bestände von Fischen und anderen Lebewesen, die wir ausbeuten. Die Kriterien, die das MSC an die Fischerei anlegt, wurden in Gesprächen von Fischern, Fischereimanagern, Fischverarbeitern, Einzelhändlern, Fischereiwissenschaftlern und Umweltgruppen festgelegt. Am wichtigsten ist, dass die Gesundheit der Bestände (einschließlich ihres Geschlechts und der Altersverteilung sowie ihrer genetischen Vielfalt) auf unbegrenzte Zeit erhalten bleibt; die Fischerei soll eine nachhaltige Nutzung anstreben, die Ökosysteme unversehrt lassen, die Auswirkungen auf Lebensräume und unerwünschte Arten (Beifang) so gering wie möglich halten, Regeln und Verfahren zur Bewirtschaftung der Bestände und zur Verringerung der Beeinträchtigungen aufstellen.“[vii]]
Unter diesen Voraussetzungen erweist sich die viel zitierte Aussage von Bertold Brecht, dass erst das Fressen komme, und dann die Moral, als irreführend. Zwar entsteht erst, wenn das Überleben gesichert ist, die Freiheit, sich höheren ethischen Werten zuzuwenden. Doch das häufig vertretene Argument, dass Menschen zuerst für ihre vitalen Bedürfnisse sorgen müssen und dann die Freiheit gewinnen, sich am Prinzip der Nachhaltigkeit zu orientieren, dass also Umweltschutz eine Sache wohlhabender Länder sei, ist jenseits der drängenden ökologischen Probleme anthropologisch falsch. Schon um zu überleben müssen auch Handlungen, die der Befriedigung biologischer Grundbedürfnisse dienen, an natürliche Prozesse angepasst und an ethischen Prinzipien orientiert sein.
Schon in der Befriedigung biologischer Bedürfnisse, in der Erzeugung von Nahrung, der Anlage von Städten und der Wahl von Fortbewegungsmitteln müssen Grenzen akzeptiert werden. Nicht alles, was gewünscht wird und technisch möglich ist, darf gemacht werden. Nur wenn die Natur in ihrer Komplexität, ihren zeitlichen Rhythmen und ihrer Eigendynamik respektiert wird, können sich Ressourcen zumindest für eine relativ lange Zeit regenerieren, so dass das Überleben und ein qualitativ gutes Leben möglich sind. Verantwortung erstreckt sich daher nicht nur auf den Menschen als Vernunft- und Kulturwesen, sondern auch auf seine vitalen Funktionen und die Mittel, die zu ihrer Befriedigung gewählt werden. Die Sorge um das eigene psycho-physische Befinden beinhaltet die für die Umwelt. Ein selbst-bestimmtes, menschenwürdiges Leben beruht gerade nicht auf der Freiheit, jederzeit alles tun zu können, was man tun will, sondern auf einem im ursprünglichen Sinn des Wortes maßvollen, Proportionen wahrenden Handeln.
Auch das Argument, jeder dürfe selbst entscheiden, wie viele Kinder er zeugt, verliert seine Gültigkeit, wenn dadurch andere Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Wenn das Recht auf ein selbstbestimmtes, menschenwürdiges Leben den Respekt vor der Freiheit des Anderen beinhaltet, dann muss der Ressourcenverbrauch ebenso wie die Kinderzahl mit den Lebensmöglichkeiten aller Menschen vereinbar sein. Die Verantwortung für die Reduktion von Umweltbelastung und Naturzerstörung liegt daher nicht nur bei den reichen Ländern mit ihrem exzessiven Lebensstil, sondern auch bei den Ländern mit zu hohen Geburtenraten, die für andere Sozialstrukturen und eine Neubewertung der Geschlechterrollen Sorge tragen müssen.
Die drohenden Folgen des Klimawandels beinhalten daher die Chance zu einem ethischen und politischen Fortschritt: Da die Biosphäre die Lebensgrundlage aller Menschen, in Europa und Afrika ebenso wie in Asien und Amerika ist, sitzen alle aufgrund ihrer psycho-physischen Konstitution buchstäblich in einem Boot. Nimmt man das Bedürfnis zu überleben und qualitativ gut zu leben als Minimal-Kriterium eines kulturübergreifenden ethischen Konsenses, dann dürfen die Eingriffe das globale System zumindest nicht großräumig und langfristig stören. „Natur ist jene basale Normalität, die, im Unterschied zu der kulturspezifischen, nicht nur faktisch, sondern prinzipiell der diskursiven Problematisierung entzogen ist. Das bezieht sich heute vor allem auf die ökologischen Erhaltungsbedingungen der Menschheit. Der gesellschaftliche und politische Konsens muß sich bei Strafe des Untergangs mit diesen von ihm unabhängigen Größen in Übereinstimmung bringen.“[viii] Schon die Leibgebundenheit des Menschen, mithin die Orientierung an den eigenen Interessen, machen eine nur auf Konventionen und Traditionen, rationalem Konsens und Interessenabwägung beruhende Ethik genauso unmöglich wie einen Relativismus kultureller Sprachspiele. Nicht abstrakte Ideen, sondern die Möglichkeiten der modernen Technik und ihr Gefahrenpotential lassen die Menschheit zusammenwachsen. Im Handeln setzen sich Menschen mit ihren Bedürfnissen und Zielen in ein Verhältnis zu etwas, das sie weder erzeugt haben noch kontrollieren können. Durch den Willen, zu überleben, gewinnt es nicht nur eine ethische, sondern auch eine existentielle Bedeutung. Trotz der Ungleichzeitigkeit verschiedener Kulturen müssen zumindest einige Werte formuliert werden, die universale Geltung haben. „Natur darf nicht länger als frei verfügbares Gut angesehen werden, das beliebig genutzt und verbraucht werden kann. Ihre Erhaltung muss Teil einer globalen Partnerschaft werden.“[ix]
Um hemmungslosem Konsumismus und der Ausbeutung der Natur entgegenzuwirken, ist, wie Jonas betont, die Wiederbelebung der Tugend des Maßes erforderlich: „Wie betätigt sich die von der Verantwortung uns neuerdings auferlegte Vorsicht? Letztlich in einer neuen Bescheidenheit der Zielsetzungen, der Erwartungen und der Lebensführung. Um die in vollem Lauf begriffene Ausplünderung, Artenverarmung und Verschmutzung des Planeten aufzuhalten, der Erschöpfung seiner Vorräte vorzubeugen, sogar einer menschlich verursachten, unheilvollen Veränderung des Weltklimas, ist eine neue Frugalität in unseren Konsumgewohnheiten vonnöten. ‚Frugalität‘: da wären wir also bei einem recht alten und erst jüngst aus der Mode gekommenen Wert. Enthaltsamkeit (continentia) und Mäßigkeit (temperantia) waren durch lange Vorzeiten des Abendlandes obligate Tugenden der Person, und ‚Völlerei‘ steht groß im kirchlichen Katalog der Laster. Die jetzt neu geforderte Frugalität hat mit persönlicher Vollkommenheit überhaupt nichts mehr zu tun, obwohl als Nebenerfolg auch dieser Aspekt zu begrüßen wäre. Gefordert ist sie im Weitblick auf die Erhaltung des terrestrischen Gesamthaushaltes, ist also eine Facette der Ethik der Zukunftsverantwortung.“[x] Es wäre jedoch falsch, würde man unter der Tugend des Maßes nur ein Mittelmaß, die Zügelung der Begierden und Verzicht verstehen. Sie beinhaltet das Einhalten von Proportionen, der Verhältnisse zwischen Entitäten. Das Maß wird eingehalten, wenn dem Menschen in seinen Bedürfnissen und der Umwelt in ihrer Vielfalt und Eigendynamik Rechnung getragen wird. Die Menschen müssen sich zu ihrer lokalen Umwelt, die immer ein Teil der Biosphäre ist, derart in eine Beziehung setzen, dass sie ihre Bedürfnisse auf die Möglichkeiten der Umwelt abstimmen. Die Maßstäbe für das Handeln finden sie nicht durch die Klärung der eigenen Bedürfnisse, sondern erst durch deren Abstimmung auf die raum-zeitlichen Möglichkeiten der Umwelt.
Will man der Vielschichtigkeit menschlicher Bedürfnisse und Ausdrucksmöglichkeiten Rechnung zu tragen, muss die Orientierung am Modell des Homo oeconomicus aufgegeben werden. Die Reduktion des zeitlichen und finanziellen Aufwandes, der zur Beschaffung, Erhaltung und Steigerung des materiellen Lebensstandards erforderlich ist, erzeugt den Freiraum für eine Vielzahl anderer Aktivitäten. Auch in der modernen Variante der Mäßigung ist der Verzicht nicht das Ziel, sondern nur ein Mittel zu einem verantwortungsbewussten Leben, einer Steigerung der Lebensqualität in Hinblick auf das sinnlich-ästhetische Erleben der Natur und der vielfältigen Möglichkeiten zu Partizipation und Kommunikation.
Bei einem maßvollen Handeln müssen auch die Zeitskalen berücksichtigt werden, die für Eigendynamik von Ökosystemen charakteristisch sind: Obwohl sich vor dem Hintergrund der modernen Ökonomie die Zeitmaßstäbe, die für den Alltag bestimmend sind, immer mehr verkürzt haben, haben viele Menschen noch immer eine gewisse Übung darin, sich ihre eigene Lebensspanne und Ereignisse vorzustellen, die sie und ihre Kinder betreffen könnten. Über viele Jahrhunderte war es ein Aspekt der Zukunftsverantwortung, Kindern Güter zu vererben, die ihnen in materieller und sozialer Hinsicht oder in Hinblick auf ihre Bildung ein besseres Leben ermöglichen würden. Bei John Rawls taucht dieser Gedanke als ‚Sparprinzip‘ wieder auf. Es beinhaltet, dass jede Generation etwas von dem, was sie erwirtschaftet hat, zurücklegt, um der nächsten Generation einen besseren Ausgangspunkt zu ermöglichen und für Krisen und Katastrophen vorzusorgen. Heute muss man die Frage, was man den eigenen Kindern und Kindeskindern vererben wird, auch auf die natürliche Lebensgrundlage beziehen.
Ein Zeitraum von mehreren Generationen kommt in den Blick, wenn man den Umgang mit Ressourcen dem Prinzip der Nachhaltigkeit unterstellt. Das Nachwachsen der Wälder oder von Fischen folgt Rhythmen, die nicht menschengemachten Zeitskalen entsprechen. Noch längere Zeitskalen kommen ins Spiel, wenn man von Ökosystemen redet. Beim Befall des Waldes durch den Borkenkäfer im Nationalpark Bayerischer Wald, bei Vulkanausbrüchen wie am Mount St. Helens oder Bränden wie im Yellowstone Nationalpark dauert die Regeneration der Natur mehrere Dekaden oder gar Jahrhunderte. Sie sind noch vom Menschen überschaubar, fordern aber bereits um der Biodiversität willen eine Zurückstellung der eigenen Wünsche und ökonomischer Interessen. Noch längere Zeitskalen kommen in den Blick, wenn man an evolutionäre und geologische Prozesse denkt, in denen neue Arten entstehen und sich Ressourcen wie Böden, Grundwasser und Öl bilden.
Kommen wir noch einmal zur Rolle der Technik zurück: Angesichts der wachsenden Zahl von Menschen auf diesem Planeten wäre eine Rückkehr zum einfachen Handwerk aussichtslos, so dass sie Alternative entweder Hochtechnologie oder Rückkehr zur Natur, die die Menschen noch immer in zwei unversöhnliche Lager spaltet, längst überholt ist. Nur moderne Formen der Hochtechnologie, wie sie sich in der Gewinnung von Solarenergie und der Tröpfchenbewässerung abzeichnen, können das Überleben sichern. Sie beruhen nicht mehr auf der Ausbeutung und Veränderung der Natur, sondern auf der Arbeit mit ihren Kräften. Mit guten Gründen gelten diese Technologien heute als Schlüsseltechnologien.
Dennoch sind rein technische Lösungen unzureichend, da sie der Vorstellung verhaftet bleiben, dass der bisherige Lebensstil mit Hilfe technischer Lösungen ungebrochen weitergeführt werden kann und nur die Effizienz gesteigert werden müsse. Eine noch stärkere Funktionalisierung, Ökonomisierung und Entsinnlichung aller Lebensbereiche wäre die Folge. Wächst zudem die Zahl technischer Hilfsmittel weiter, dann wird sich der ökologische Fußabdruck nicht verkleinern, obwohl die Effizienz einzelner Geräte, von Autos, Waschmaschinen und Kühlschränken, erhöht wird.
Da die Technik, so haben wir gesagt, für sich genommen keine normative Orientierung beinhaltet, muss sie durch ethische Werte geleitet werden, zu denen auch die der Natur gehören. Und sie muss von einer Neubestimmung der Vorstellung von Lebensqualität, Fortschritt, Glück und Sinn geleitet werden. Diese lassen sich nur unzureichend durch materielle Kategorien wie die jährliche Steigerung des Prokopfeinkommens und ständig wachsenden Konsum bestimmen. Erst wenn die Ökonomie und technische Entwicklung in eine Hierarchie von Werten, die das menschliche Leben insgesamt bestimmen, eingeordnet werden und komplexe ökologische Zusammenhänge berücksichtigt, ist die Grundlage für ein menschenwürdiges Leben gegeben.
Doch haben Menschen überhaupt das Recht, den Lebensraum des gesamten Planeten für sich zu beanspruchen? Wenn, wie die Evolutionstheorie lehrt, auch andere Kreaturen bereits ein Moment der Subjektivität besitzen und qualifizierte Perzeptionen ebenso wie Lust und Schmerz unterscheiden können, dann muss das anthropozentrische Interesse an der Erhaltung der Natur überschritten werden. Zumindest die belebte Natur ist nicht das ganz Andere, Fremde, so dass, wie der Soziobiologe E.O. Wilson argumentiert, die Biophilia, die Fähigkeit, für andere Wesen Sympathie zu empfinden, zur evolutionären Grundausstattung des Menschen gehört. Die Fähigkeit zur ‚Einsfühlung’, so betont auch der Philosoph Max Scheler, ist die Voraussetzung für eine Ethik, die das Lebendige als einen zwar rangniedrigeren, jedoch die Kultur fundierenden Wert achtet. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, mit anderen Lebewesen zu kommunizieren, so dass sich der eigene Lebenshorizont in emotionaler und kognitiver Hinsicht erweitert. Sieht man in den unterschiedlichen Manifestationen des Lebenswillens eine implizite Bejahung ihres Seins, dann ist die belebte Natur kein wertindifferenter Funktionszusammenhang. Alle Lebewesen haben, wie Jonas betont, ein sittliches Eigenrecht, eine Würde im Sinne der Schweizer Bundesverfassung.[xi]
Während sich die kontinentaleuropäische Tradition auf die Idee der Würde der Kreatur beruft, argumentiert die angelsächsische Tradition in Anlehnung an Locke, dass jedes Mitglied einer Gemeinschaft ein Recht auf den Schutz seines Lebens habe. Trotz unterschiedlicher Ausgangspunkte konvergieren die Argumente in der Überzeugung, dass der Radius ethischer Pflichten erweitert werden müsse. Die Begrenzung von Eingriffen in die belebte Natur ist derzeit vor allem für die Forschung mit Lebendigem, für die Biotechnologie und landwirtschaftliche Praktiken, bedeutsam.
Da man Individuen und Arten nur schützen kann, wenn man auch ihr Lebensumfeld erhält, muss letztlich die Biosphäre insgesamt, zumindest soweit es in der Hand der Menschen liegt, erhalten werden. Wenn die Relation zur Natur konstitutiv für die menschliche Identität ist, können Befriedigung und Erfüllung nicht durch das Leiden und die Vernichtung anderer Kreaturen erkauft werden. Das eigene Glück beinhaltet das Bemühen um das Wohlbefinden anderer Wesen. Schon in der Befriedigung sinnlich-vitaler Bedürfnisse, der Art der Nahrungsproduktion etwa, müssen Werte konkretisiert werden, die die Schonung der Natur im Blick haben. Die Verantwortung erstreckt sich nun nicht mehr nur auf sich selbst und die Mitmenschen, sondern auf alle Lebewesen, letztlich auf die gesamte Biosphäre, wie Jonas betont. “Die gesamte Biosphäre unseres Planeten in ihrer neu enthüllten Verletzlichkeit beansprucht gegenüber den Eingriffen des Menschen ihren Anteil an der Achtung, die allem gebührt, das seinen Zweck in sich trägt, d.h. allem Lebendigen.”[xii] Während der erweiterte Kategorische Imperativ von Jonas anthropozentrisch bleibt und damit auf einen Minimalkonsens zielt, der die Natur als Lebensgrundlage aller Menschen um des Menschen willen schützt, zielt die Argumentation letztlich auf eine holistische Ethik, die die gesamte Biosphäre um ihrer selbst willen achtet.
Die Anerkenntnis des Eigenwertes von insbesondere von Tieren bedeutet nicht, dass sie überhaupt nicht genutzt werden dürfen. Auch das menschliche Zusammenleben, Freundschaft und Ehe eingeschlossen, basiert darauf, dass Menschen sich immer auch gegenseitig für Ziele gebrauchen; sie sollten, so die Formulierung des kategorischen Imperativs, lediglich nie nur zum Mittel werden. Überträgt man diesen Gedanken auf den Respekt gegenüber Tieren, dann haben Menschen die Pflicht, sie so zu nutzen, dass ihnen genügend Raum für ein artgemäßes Leben bleibt. „Was aber heißt: Auch die Selbstzwecklichkeit des Mitmenschen oder Mitgeschöpfes zu achten? Es heißt, im Konfliktfall nicht einfach die eigenen Interessen und Güter vorzuziehen, sondern die Interessen und Güter des Anderen fair in die Güterabwägung einzubringen.“[xiii]
Auf einer anderen Ebene kommen wir daher noch einmal zu der Idee der Gerechtigkeit als Fundamentalprinzip der Ethik zurück: Wie jedes Lebewesen schulden auch Menschen ihr Leben der Aktivität zahlloser anderer Kreaturen. Dadurch sind sie verpflichtet, etwas von dem, was sie erhalten, zurückzugeben. Fairness oder ein gerechter Ausgleich von Geben und Nehmen bedeutet jedoch nicht, dass jeder das Gleiche erhält, sondern das Seine, das also, was angemessen ist. Entscheidend ist, dass Tiere als psycho-physische Einheit betrachtet werden, deren Ziel nicht nur das Überleben, sondern die Entfaltung ihrer artgemäßen Verhaltensweisen ist. Sie sollten die Güter erhalten, die es ihnen ermöglichen, ihre vitalen, emotionalen und sozialen Bedürfnisse zu befriedigen. Dazu muss ihnen eine entsprechende Umgebung gewährt werden, zu der oft auch andere Tiere gehören.
Auch der Umgang mit der Natur ist daher nicht nur kulturrelativ; er beruht nicht nur auf Interessensabwägungen, rationalen Argumenten und Konsens. Es handelt sich um ein Gut, das die unterschiedlichen Interpretationen der Natur überschreitet. Jonas formuliert: „‘Wirklich‘ der-Mühe-wert muß bedeuten, daß der Gegenstand der Mühe gut ist, unabhängig vom Befinden meiner Neigungen. Eben dies macht ihn zur Quelle eines Sollens, mit dem er das Subjekt anruft in der Situation, in der die Verwirklichung oder Erhaltung dieses Guten durch dieses Subjekt konkret in Frage steht. Das unabhängig Gute kann den freien Willen nicht zwingen, es zu seinem Zweck zu machen, aber es kann ihm die Anerkennung abnötigen, daß dies seine Pflicht wäre.“[xiv] Trotz der Variation kulturell und kontextuell bedingter Wertungen ist ein Rahmen vorgegeben, an dem Handlungen immer wieder neu ausgerichtet werden sollten. Wenn es, wie Kant beobachtet hat, Handlungen gibt, die der Würde des Menschen widersprechen, weil dieser einen Eigenwert hat, dann gibt es auch Handlungen, die mit dem Eigenwert nicht-menschlicher Kreaturen und der Biosphäre nicht zu vereinbaren sind. Hören wir noch einmal Jonas: „Nur eine Ethik, die in der Breite des Seins und nicht lediglich in der Einzigkeit oder Absonderlichkeit des Menschen begründet ist, kann Bedeutung im All der Dinge haben.“[xv] Da jedoch nur vernunftbestimmte Wesen den der Natur inhärenten Wert erkennen und anerkennen können, können auch nur sie bewusst gegen ihn verstoßen. Nur menschliches Handeln kann im ethischen Sinne gut oder böse sein.
Die Anerkenntnis der Grenzen des Machbaren bedeutet keineswegs eine Beschränkung der eigenen Möglichkeiten und einen Verzicht auf die Verwirklichung der eigenen Wünsche. Nur indem Menschen etwas akzeptieren, das unabhängig von ihren Vorstellungen und Interessen existiert, können sie ihren eigenen Lebenshorizont überschreiten. Der Verzicht auf die Beherrschung der Natur ist die Voraussetzung für die Partizipation an ihr. Da auch die menschliche Identität relational bestimmt ist, beruht auch sie auf einem Prozess der Selbstüberschreitung zu einem Gegenüber, zum mitmenschlichen Du und zu anderen Kreaturen. Im Unterschied zu Kant wird die eigene Freiheit nicht nur durch die Freiheit des Anderen begrenzt; dessen Freiheit ist seinerseits die Voraussetzung, um Beziehungen eingehen zu können, die die Grundlage der Selbstentfaltung sind. Nur wenn Menschen den Anspruch anderer Kreaturen auf ihr Selbstsein akzeptieren, können sie selbst ein Leben in Würde führen. Die Natur als Mitwelt wahrzunehmen bedeutet, dass ein Füreinanderdasein an die Stelle des einseitigen Benutzens tritt. Die Voraussetzung von Gegenseitigkeit ist, dass Menschen sich nicht nur als Akteure, sondern auch als Wesen begreifen, die etwas empfangen, das sie zu einer Gegengabe und zu Dankbarkeit, zu Behutsamkeit und Achtung verpflichtet. Jonas formuliert: „Jetzt beansprucht die gesamte Biosphäre des Planeten mit all ihrer Fülle von Arten, in ihrer neu enthüllten Verletzlichkeit gegenüber den exzessiven Eingriffen des Menschen, ihren Anteil an der Achtung, die allem gebührt, das seinen Zweck in sich selbst trägt – d.h. allem Lebendigen. Es ist das Übermaß an Macht, das dem Menschen diese Pflicht auferlegt: So kommt es, dass die Technik den Menschen in eine Rolle einsetzt, die nur die Religion ihm manchmal zugesprochen hatte: die eines Verwalters und Wächters der Schöpfung.“[xvi]
Die Bereitschaft, die eigenen Interessen nicht zum Maß aller Dinge zu erheben, gehört zu den größten Herausforderungen auf dem Weg zu einer Neuorientierung. Welche Lebensqualitäten könnten daher so verlockend sein, dass sie zu einer Veränderung des Lebensstils, zur Überwindung von Bequemlichkeit und liebgewordenen Gewohnheiten motivieren? An welchen Werten müsste sich eine Ökonomie orientieren, die nicht nur einem würdelosen Konsumismus eine Absage erteilt, sondern auch die Bedingungen des Lebens bewahrt, die nicht auf Ausbeutung, sondern auf Ausgleich und Teilhabe beruht?
- ‚Heuristik der Furcht‘ (Jonas): Sorge um die Zerstörung der Lebensgrundlage
- Gewinn an innerer Freiheit und Lebensqualität durch die Fähigkeit zur Selbstbegrenzung: Durch den Wechsel vom ‚Haben‘ zum ‚Sein‘ wächst die Freiheit, zwischen Gütern wählen zu können und sie im Rahmen des eigenen Lebens zu bewerten. Durch die innere Autonomie ist man weniger durch Werbung manipulierbar oder vom Statusdenken und dem Vergleich mit anderen abhängig.
- Dadurch entwickelt sich auch ein Gefühl für die Würde, den Eigenwert (von sich und anderen), während triebgeleiteter Konsumismus und Gier (‚Völlerei‘) zunehmend als würdelos (Jonas) empfunden werden.
- Gewinn an Lebenszeit (Zeitwohlstand): Während alle materiellen Güter ersetzbar sind, ist die Lebenszeit nicht ersetzbar. Deshalb haben schon die stoischen Philosophen eine meditative Übung empfohlen, die zur Sammlung der Aufmerksamkeit auf die Gegenwart und die Erhöhung von Bewusstheit und Lebensintensität führen sollte: Sie bestand in der ‚Praemeditatio Malorum‘, dem Nachdenken über das größtmögliche Übel, das Menschen treffen kann: den Tod. Was würde einem im Angesicht des eigenen Todes, der jederzeit kommen kann, noch etwas bedeuten? Was wäre so wertvoll, dass man es dennoch tun würde? Würde man noch Lebenszeit opfern, um immer mehr zu arbeiten, um sich ein größeres Auto zu kaufen, nur weil der Nachbar auch ein großes Auto hat?
- Begegnung mit anderen und der Natur als Horizonterweiterung: Nur wer in der Lage ist, seine eigenen Interessen zu überschreiten, kann andere und anderes wahrnehmen. Während die Identifikation mit den eigenen Interessen zu einer Art Gefangenschaft in sich führt, dem ‚homo curvatus in seipso, der immer nur um sich kreist und alles im Licht der eigenen Wünsche sieht, führt die Selbstüberschreitung zu einer Teilhabe an der Welt in ihrer Vielfalt. Da kein Mensch alles aus sich heraus entwickeln kann, ist die Teilhabe die Grundlage einer Erweiterung des eigenen Horizontes. Glück durch das Entdecken der Fülle des Lebens.
- sinnlich-leibliches Wohlbefinden durch eine intakte Umwelt: qualitativ gute Nahrung, Luft, Wasser und weniger Lärmbelästigung als Grundlage von Gesundheit
- Freude an der Ästhetik der Natur: Es wäre einseitig, würde man nur die bedrohliche Dimension des Klimawandels betonen und Furcht zur entscheidenden Motivation für eine Verhaltensänderung machen. Die Erkenntnis der Verletzlichkeit der Natur birgt die große Chance, sie in neuer Weise zu entdecken. Noch nie zuvor wurden so viel Engagement und Kapital eingesetzt, um bedrohte Arten zu schützen, intakte Ökosysteme zu bewahren und zerstörte Landschaften zu renaturieren. Nicht nur das Bewusstsein der Verantwortung, auch die Freude an der Schönheit der Natur wird inzwischen für zahllose Menschen zum Impuls, um ein neues Verhältnis zur Natur zu erproben. Sie tritt als unverzichtbare Grundlage der Kultur und qualitative Bereicherung des Lebens in den Blick. Dazu muss man ‚Natur allerdings auch Natur sein lassen können‘, d.h. den eigenen Drang nach Macht und den Willen, die Welt nach dem eigenen Bilde zu formen, zurücknehmen können.
- Sieht man die Natur als Teil der eigenen Identität, weil man ohne sie nicht existieren könnte, dann ist die Verantwortung für die Natur ein Aspekt der Verantwortung für sich und die Mitmenschen
- Gespür auch für Gerechtigkeit in Hinblick auf die Natur: Nicht nur anderen Menschen, auch der Natur verdanken wir das eigene Leben: biographisch, indem wir uns ernähren können, menschheitsgeschichtlich durch den Prozess der Evolution. Der Raubbau der Natur müsste daher durch einen Ausgleich korrigiert werden, bei dem Menschen für die Güter, die sie zur Erhaltung ihres Lebens nehmen, wieder etwas Äquivalentes zurückgeben, so dass die Natur sich regenerieren und weiter entwickeln kann.
- Gefühl für die Unterscheidung von sinnlosen und sinnvollen Tätigkeiten: Das Streben nach Lust und Befriedigung ist zur Entspannung nötig, vermittelt durch seine Kurzlebigkeit und Einseitigkeit jedoch kein Gefühl von Lebenssinn. Dieses kann nur entstehen, wenn Zeit ist für Tätigkeiten, die als Horizonterweiterung empfunden werden. Von daher ist es irreführend, dass in den Medien ‚die Reichen‘ dargestellt werden als Menschen, die nur Parties, Strand, teure Boote und exquisites Essen im Sinn haben. Nicht der Reichtum ist das Problem, sondern der sinnlose Umgang mit ihm und dem eigenen Leben. Mit Geld könnte man viele sinnvolle Dinge tun, die man ohne es nicht tun kann und für die auch Staaten nicht verantwortlich sind. Wichtig wäre es daher, andere Vorbilder darzustellen, bei denen Geld und Besitz die Grundlage für Tätigkeiten sind, die Kultur und Natur bereichern.
[1]J.H. Reichholf: Ende der Artenvielfalt? Gefährdung und Vernichtung von Biodiversität, Frankfurt/M. 2008, 14.
[ii] H. Jonas: Technik, Medizin und Ethik. Die Praxis des Prinzips Verantwortung, Frankfurt/M. 1987, 19f.
[iii] H.Jonas: Technik, Medizin und Ethik (1985) 68.
[iv]Ferré, F.: Art. Technology, in: Encyclopedia of Science and Religion, New York 2003, Bd.II, 868. – Vgl. R.Kather: Von der Nachahmung zur Veränderung der Natur. Vom menschlichen Schöpfertum und seinen Grenzen, in: B.Steinhof – B.Feininger (Hg.): Orte – Worte – Wege. Beiträge zur Kultur, Altern und lernen, Frankfurt/M. 2010, 91-111.
[v]H.Jonas: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt/M., Frankfurt/Main 19823, 36.
[vi]Enquête-Kommission ‚Schutz des Menschen und der Umwelt’ (1994). – Vgl. K. Kümmerer: Rhythmen der Natur. Die Bedeutung von Eigenzeiten und Systemzeiten, in: M. Held/ K.Geißler (Hg.): Von Rhythmen und Eigenzeiten, Stuttgart 1995, 97─118.
[vii]J. Diamond: Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder untergehen, Frankfurt/M. 20053, 592;594.
[viii] R. Spaemann: Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns, Stuttgart 2001, 142.
[ix] J.H. Reichholf: Ende der Artenvielfalt (2008) 210.
[x] H.Jonas: Technik, Medizin und Ethik (1987) 67f.
[xi] Vgl. R.Kather: Die Wiederentdeckung der Natur. Naturphilosophie im Zeichen der ökologischen Krise, Darmstadt 2012.
[xii] H.Jonas: Technik, Medizin und Ethik (1987) 46.
[xiii]M.Rosenberger: Theologische Ethik, in: C. Otterstedt/ M. Rosenberger (Hg.): Gefährten – Konkurrenten – Verwandte. Die Mensch-Tier-Beziehung im wissenschaftlichen Diskurs, Göttingen 2009, 378.
[xiv] H.Jonas : Das Prinzip Verantwortung (19823) 161.
[xv] H.Jonas: Das Prinzip Leben. Aufsätze zu einer philosophischen Biologie, Frankfurt/M./ Leipzig 1994, 403.
[xvi] H.Jonas: Technik, Medizin und Ethik (1987) 46-48.